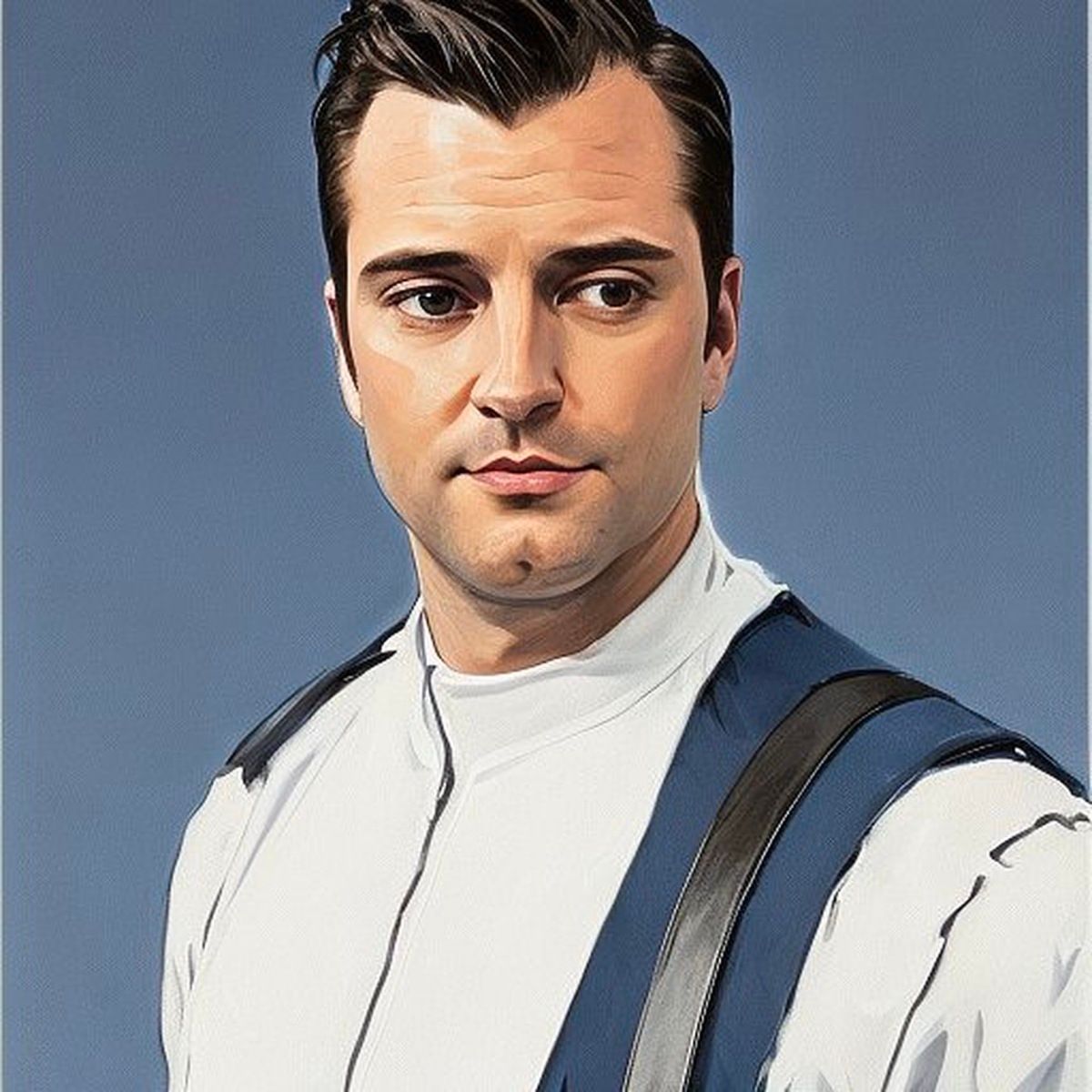TLDR: Das Massachusetts Institute of Technology (kurz MIT) hat die weltweit erste Gehirnscan-Studie zu ChatGPT-Nutzung abgeschlossen – und die Ergebnisse sind beunruhigend. Die Forscher:innen wollten eine einfache Frage beantworten: Was passiert in unserem Kopf, wenn wir KI zum Denken verwenden? Das Ergebnis: KI steigert nicht unsere Leistung, sondern schwächt unsere Gehirnkraft. Und rund vier Monate Datensammlung zeigen: Wir messen Produktivität möglicherweise völlig falsch. Die Langzeiteffekte sind noch unbekannt. Was passiert nach Jahren der KI-Nutzung? Wie entwickeln sich die Gehirne von Kindern, die mit ChatGPT aufwachsen? Die nächsten Jahre werden zeigen, ob wir eine Generation schaffen, die brillant mit KI umgeht – oder eine Generation, die ohne KI nicht mehr denken kann.
Was mit unserem Gehirn auf ChatGPT passiert
Die Untersuchung wurde vom MIT Media Lab unter der Leitung von Nataliya Kosmyna durchgeführt. Über vier Monate begleiteten die Forschenden insgesamt 54 Studierende aus fünf Hochschulen im Grossraum Boston. Die Teilnehmenden wurden in drei Gruppen eingeteilt: Eine nutzte ChatGPT zur Unterstützung beim Schreiben, eine verwendete Google für Recherchezwecke, die dritte arbeitete völlig ohne digitale Hilfsmittel.
Ziel der Studie war es, objektive Unterschiede in der Gehirnaktivität und Gedächtnisleistung zwischen diesen Gruppen sichtbar zu machen. Dazu wurden die Schreibphasen standardisiert: Alle Teilnehmenden verfassten Essays zu SAT-ähnlichen Themen. Parallel wurden mithilfe eines 32-Kanal-EEG Hirnaktivitäten gemessen. Die erhobenen Daten wurden durch Interviews und eine KI-gestützte Textanalyse ergänzt.
Neben der Erhebung qualitativer Unterschiede in den Texten und der subjektiven Wahrnehmung der Proband:Innen stand insbesondere die Analyse der neuronalen Konnektivität im Zentrum. Die Forscher:Innen nutzten dazu die Dynamic Directed Transfer Function (dDTF), um gerichtete Verbindungen zwischen Gehirnregionen zu erfassen.
Diese Kombination aus qualitativer, quantitativer und neurophysiologischer Analyse macht die Studie zu einem wegweisenden Beitrag in der Forschung zu Mensch-KI-Interaktion (Kosmyna et al., 2025).
KI ersetzt niemanden sofort, aber sie entlarvt, wer aufgehört hat, sein eigenes Gehirn zu nutzen.
Erinnerungsfähigkeit und neuronale Konnektivität
Die auffälligsten Unterschiede zeigten sich bei der Fähigkeit, sich an zuvor Geschriebenes zu erinnern. In der ersten Sitzung konnten 83,3 % der ChatGPT-Nutzer:Innen (15 von 18 Personen) keinen einzigen Satz aus ihrem eigenen Text korrekt wiedergeben.
Diese Ergebnisse weisen auf eine Reduktion aktiver, integrativer Denkprozesse hin. Besonders betroffen waren Verbindungen zwischen Parietal- und Temporallappen – Regionen, die mit Sprachverarbeitung, Gedächtnisbildung und kreativer Problemlösung assoziiert sind.
Die Zahlen legen nahe: Wer mit ChatGPT schreibt, lagert zentrale kognitive Prozesse aus – und entlastet dadurch nicht nur den Arbeitsspeicher, sondern schaltet ganze Netzwerkstrukturen temporär ab.
Die Ergebnisse überraschen übrigens nicht, denn in diesem Bereich wird schon länger geforscht, darauf gehe ich gleich etwas näher ein. Fakt ist aber: wir nutzen Technologie viel zu oft auf “Autopilot” statt aktivem “Copilot” (und nein ich meine nicht Microsofts Produkte damit, sondern dass wir bewusst auch an unseren Arbeiten mitarbeiten).
Kognitive Entlastung und die Theorie dahinter
Die beobachtete Reduktion der neuronalen Aktivität ist kein isoliertes Phänomen. Sie folgt einem bekannten Prinzip der kognitiven Entlastung (Cognitive Offloading): das Gehirn spart Ressourcen, wenn externe Systeme Informationen oder Denkleistungen bereitstellen. Bereits 2011 konnte gezeigt werden, dass Menschen sich Informationen schlechter merken, wenn sie wissen, dass diese jederzeit online verfügbar sind – bekannt als „Google-Effekt“.
Ein verwandtes Beispiel betrifft die Nutzung von GPS-Systemen. Studien mit Londoner Taxifahrern zeigten früher schon, dass intensive Nutzung innerer Orientierungskarten (sog. „The Knowledge“) zu einer messbaren Vergrösserung des Hippocampus führt – der Hirnregion für räumliches Gedächtnis. Wird Navigation dagegen ausgelagert, schrumpft dieser Bereich.
Diese Befunde unterstreichen: Das Gehirn funktioniert nach dem Prinzip „Use it or lose it“. Werden spezifische Denkfunktionen nicht regelmässig beansprucht, verkümmern die dazugehörigen neuronalen Bahnen.
Langfristig kann dies nicht nur die geistige Flexibilität, sondern auch die kognitive Reserve schwächen – also jenes mentale Polster, das uns gegen Alterungsprozesse und Stress schützt. Auch wenn das Gehirn kein Muskel ist, so kann hier dasselbe Prinzip angewendet werden: Trainiere, worin Du besser werden willst indem du bewusst Techniken und Bereiche forderst und förderst.
Lernen braucht Anstrengung und eigene Formulierung
Zurück zur Studie: Die erschreckend schwache Erinnerungsleistung der ChatGPT-Nutzer:Innen lässt sich lernpsychologisch gut erklären. Eine zentrale Erkenntnis ist der „Generierungseffekt“: Informationen, die man selbst generiert (statt sie passiv zu lesen), werden signifikant besser im Gedächtnis verankert (Slamecka & Graf, 1978). Aktives Formulieren aktiviert Sprachzentren, Arbeitsgedächtnis und emotionale Assoziationen gleichzeitig.
Zudem bestätigt die Forschung, dass sogenannte „erwünschte Schwierigkeiten“ (Desirable Difficulties) den Lernprozess zwar kurzfristig erschweren, aber langfristig zu robusterem und besser abrufbarem Wissen führen. Wenn uns das Denken zu leicht gemacht wird, bleibt weniger haften (Bjork, 1994).
In diesem Sinne schwächt KI-Nutzung nicht per se das Gedächtnis – sie tut es aber, wenn sie unreflektiert eingesetzt wird und die menschliche Eigenleistung verdrängt.
Diese Prinzipien stehen im Widerspruch zur blinden Nutzung von ChatGPT, das sofort formulierbare Inhalte liefert – ohne mentalen Widerstand, ohne Suche nach Ausdruck, ohne Strukturierungsarbeit. Das Schreiben wird technisch einfacher, aber kognitiv flacher.
Langfristige Folgen und gesellschaftliche Implikationen
Die Resultate der vierten Testsitzung sind besonders bedeutsam: Selbst nach dem Wechsel von ChatGPT zu eigenständigem Schreiben (LLM-to-Brain) blieben die neuronalen Aktivitäten gedämpft. Dies zeigt, dass der kognitive Effekt der KI-Nutzung nicht sofort reversibel ist – ein Hinweis auf neuroplastische Anpassung, bei der ungenutzte Gehirnareale sukzessive abgeschwächt werden.
In Verbindung mit dem Konzept der kognitiven Reserve entsteht ein langfristiges Risiko. Wer regelmässig kognitive Aufgaben an KI delegiert, ohne eigene Denkleistung einzubringen, baut keine Reserve auf – im Gegenteil: Denkfähigkeiten werden nicht trainiert, sondern abgebaut. Das kann zu reduzierter geistiger Flexibilität, erhöhter Vergesslichkeit und geringerer Problemlösungskompetenz führen – nicht nur kurzfristig, sondern über Jahre hinweg.
Für Bildungseinrichtungen ergibt sich daraus ein klarer Handlungsauftrag: Es braucht curriculare Vorgaben, die nicht nur den Umgang mit KI regeln, sondern auch den Erhalt kognitiver Selbstständigkeit fördern. Prüfungsformate, Lehrziele und Evaluationskriterien müssen angepasst werden, um nicht nur Output, sondern auch geistige Beteiligung sichtbar zu machen.
Auch für Unternehmen wird die Thematik relevant. Wer Mitarbeitende systematisch “durch KI entlastet“, riskiert langfristig intellektuelle Monotonie und einen Rückgang kreativer Innovationskraft. Es braucht eine neue Form von „digitaler Ergonomie“: Werkzeuge wie ChatGPT sollten nicht als kognitive Krücke, sondern als strategisches Exoskelett dienen – das den Menschen stärkt, nicht ersetzt.Evidenzbasierte Empfehlungen für den KI-Einsatz
Die Forschenden empfehlen stattdessen einen hybriden, phasenbasierten Ansatz, bei dem kognitive Eigenleistung erhalten bleibt und gezielte KI-Unterstützung für Effizienz sorgt. Dieses Modell basiert auf dem Prinzip der „zeitlichen Staffelung“: Zuerst denken, dann delegieren.
In der Praxis bedeutet das: Zunächst sollen Nutzer:Innen 15–20 Minuten eigenständig Ideen entwickeln, Gliederungen entwerfen und Argumente formulieren. Erst im Anschluss – etwa für den Feinschliff von Sprache, Stil oder Orthografie – wird die KI hinzugezogen.
Die Studie zeigte: Wer diese Reihenfolge einhielt, wies sowohl stärkere neuronale Aktivität als auch höhere Textqualität auf.
Ein zweiter Aspekt betrifft die aufgabenspezifische Nutzung. Die Forschung legt nahe, dass für kreative oder analytische Aufgaben (z. B. Ideengenerierung, Problemlösung) der Mensch in Vorleistung treten sollte. Für formal-sprachliche Tätigkeiten hingegen (z. B. Grammatik, Formatierung) kann KI eine sinnvolle Entlastung darstellen. Dieses selektive Vorgehen reduziert die Gefahr kognitiver Abhängigkeit und schützt zentrale Denkprozesse.
Und während des Kompetenzerwerbs, etwa in Schule oder Studium, sollte auf eigenständige kognitive Aktivierung gesetzt werden. In späteren Produktionsphasen (z. B. Abschlussarbeiten, Fachtexte) kann KI zur Effizienzsteigerung beitragen. Eine klare Trennung von Lern- und Produktionskontexten ist hierbei essenziell.
Oder anders formuliert:
„Nicht KI ersetzt den Menschen heute, sondern jene, die Denken verlernt haben, werden morgen jenen überholt, die KI bewusst als kognitives Werkzeug nutzen und ihr eigenes Gehirn weiterhin trainieren.“
Und darum ist vielleich unser neues Buch etwas für Dich?
Ein ARBEITSBUCH zum Thema: KI und Sichtbarkeit auf Social Media - denn: Deine Reichweite ist kein Zufall, sie ist eine Entscheidung.
KI Social Media Magie: Dein einfacher Weg zum Social Media Erfolg auf Instagram, LinkedIn, TikTok und Co.! Hier gehts zum Buch.
Kann ich Dir weiter helfen? Fragen zu KI und Digitalen Geschäftsmodellen? #fragRoger
Willst du mehr wissen? Sehr gerne komme ich auch bei Dir, bei deiner Firma, deiner ERFA Gruppe oder deinem Verband vorbei und helfe mit einem Workshop oder Input Referat.
Lass uns gerne mal unverbindlich sprechen. Also wenn ich helfen kann, wende dich gerne an mich #fragRoger und abonniere meinen offiziellen Podcast.
Disclaimer: dieser Artikel wurde nach meinem eigenen Wissen und dann mit Recherchen mit KI (Perplexity.Ai und Gemini.Google.com) manuell zusammen gestellt und mit Deepl.com/write vereinfacht. Der Text wird dann nochmals von zwei Personen meiner Wahl gelesen und kritisch hinterfragt. Das Bild stammt von Ideogram.Ai und ist selbst erstellt. Dieser Artikel ist rein edukativ und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Bitte melde dich, wenn Du Ungenauigkeiten feststellst, danke.
Quellen und weitere Informationen
Kosmyna, N., et al. (2025). Your Brain on ChatGPT: Measuring Brain Activity during LLM-assisted Writing. arXiv. https://arxiv.org/abs/2506.08872
Sparrow, B., Liu, J., & Wegner, D. M. (2011). Google Effects on Memory: Cognitive Consequences of Having Information at Our Fingertips. Science, 333(6043), 776–778. https://doi.org/10.1126/science.1207745
Maguire, E. A., et al. (2006). Hippocampus, 16(12), 1091–1101 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17024677/
Stern, Y. (2002). Journal of the International Neuropsychological Society, 8(3), 448–460. https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-the-international-neuropsychological-society/article/abs/what-is-cognitive-reserve-theory-and-research-application-of-the-reserve-concept/B6524DF8FC814A462004141F7B19BCF4
Bjork, R. A. (1994). In J. Metcalfe & A. Shimamura (Eds.), Metacognition: Knowing about knowing (pp. 185–205). MIT Press. https://psycnet.apa.org/record/1994-97967-009
Slamecka, N. J., & Graf, P. (1978). Journal of Experimental Psychology, 4(6), 592–604. https://www.researchgate.net/publication/232485723_The_Generation_Effect_Delineation_of_a_Phenomenon