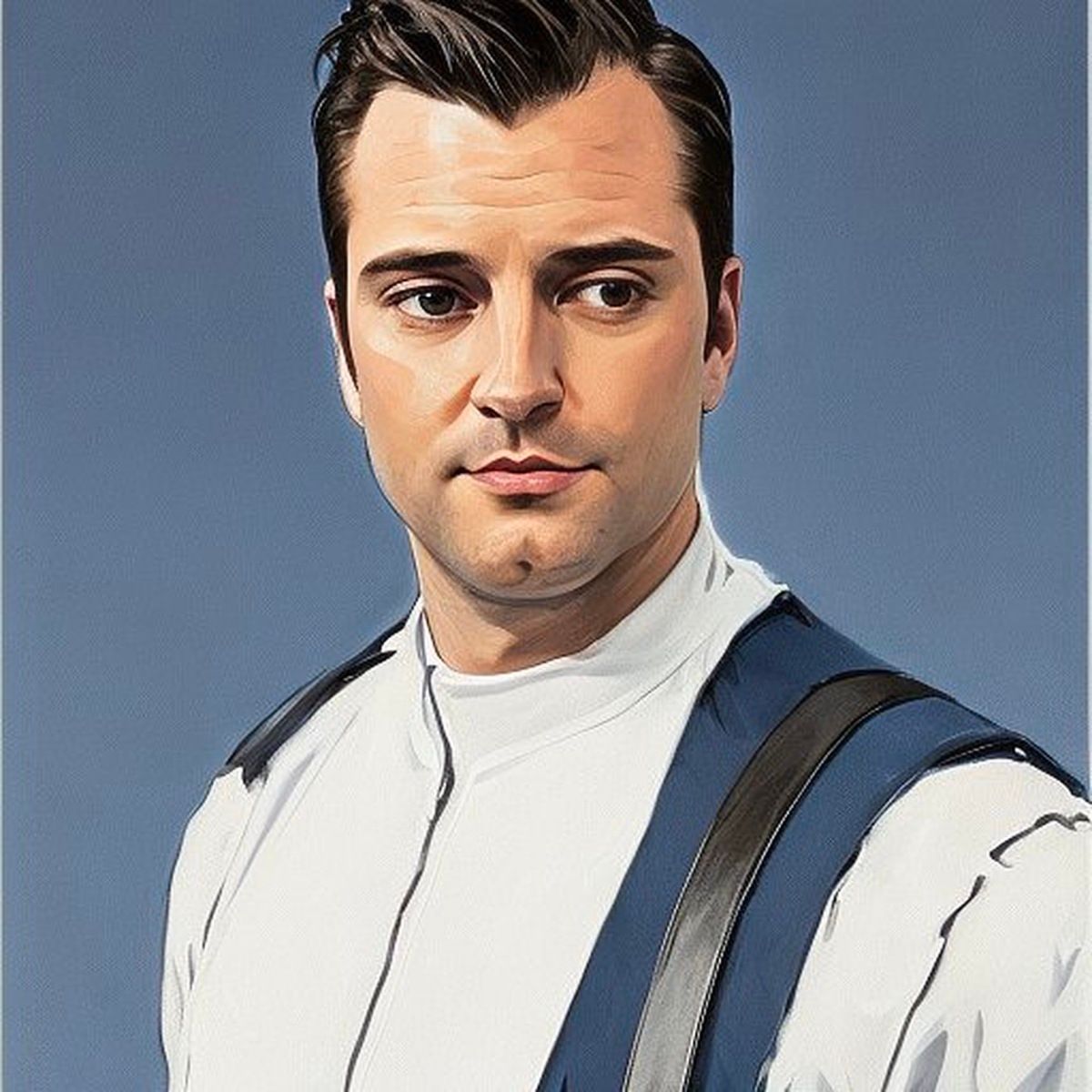TLDR: Wie real ist das Wachstum der KI-Industrie – und wie viel davon ist nur ein Spiegel ihrer eigenen Finanzierungsstrukturen? Zirkuläre Deals beschreiben eine Praxis, bei der Konzerne in Unternehmen investieren, die das Kapital wiederum nutzen, um Produkte oder Services beim ursprünglichen Investor zu kaufen. Besonders im KI-Sektor sind solche Kreisläufe verbreitet: Tech-Giganten finanzieren KI-Labore, die ihre Cloud-Dienste oder Chips bei denselben Konzernen beziehen. So entsteht ein Ökosystem, das nach Aussen nach Innovation aussieht, intern jedoch primär Geld zwischen denselben Akteuren verschiebt.
Die Finanzwelt kennt ein Phänomen, das so elegant wie riskant ist: Zirkuläre Deals. Was zunächst nach einer harmlosen Bezeichnung klingt, beschreibt eine Praxis, bei der Geld zwischen einer überschaubaren Gruppe von Unternehmen im Kreis fliesst - und dabei den Eindruck explosiven Wachstums erweckt. Das Prinzip ist bestechend einfach: Ein Konzern investiert Milliarden in ein anderes Unternehmen, welches das erhaltene Kapital postwendend verwendet, um Produkte oder Dienstleistungen beim ursprünglichen Investor einzukaufen. Ein perfekter Kreislauf entsteht, in dem jeder Beteiligte gleichzeitig Geldgeber, Lieferant und Kunde ist.
Das Besondere an dieser Entwicklung: Sie findet nicht in irgendwelchen Private Equity Hinterzimmern statt, sondern in aller Öffentlichkeit, dokumentiert in Quartalsberichten und Investorenpräsentationen. Die beteiligten Konzerne kommunizieren ihre Deals stolz, feiern Wachstumsrekorde und treiben ihre Aktienkurse in die Höhe. Dass das Geld dabei oft nur die Richtung wechselt, ohne je das System zu verlassen, erwähnt dabei aber kaum jemand.
Die Anatomie eines Kreislaufs: Wie eine Industrie die eigene Nachfrage erschafft
Tauchen wir mal ein in ein Beispiel: Ein nicht genannter Technologiekonzern stellt der KI-(also LLM) Hersteller:In mehrere Milliarden zur Verfügung. Das Labor nutzt diese Investition, um Cloud-Computing-Dienste im Wert von Milliarden beim ursprünglichen Geldgeber zu buchen. Der Chiphersteller investiert seinerseits in dasselbe KI-Labor, welches sich im Gegenzug verpflichtet, Prozessoren für ebensoviele (oder etwas weniger) Milliarden beim Investor zu bestellen. Der Chipproduzent meldet Rekordaufträge, seine Aktie steigt, Anleger jubeln. Dass diese Aufträge direkt aus der eigenen Investition finanziert werden, geht im allgemeinen Enthusiasmus unter. Die Kette erweitert sich kontinuierlich: Cloud-Anbieter kaufen Chips beim Chiphersteller, das KI-Labor bucht Kapazitäten beim Cloud-Anbieter, und alle zusammen erschaffen sie eine Wertschöpfungskette, die primär aus gegenseitigen Finanzierungen besteht.
Das zentrale Problem zirkulärer Deals liegt einerseits also in der Erzeugung künstlichen Wachstums. Wenn Umsätze primär dadurch entstehen, dass investiertes Geld im Kreis zurückfliesst, entsteht zwar buchhalterisch eine beeindruckende Performance - doch die fundamentale Frage bleibt unbeantwortet: Existiert überhaupt eine echte Nachfrage ausserhalb dieses geschlossenen Systems? Die Marktdynamik wird intern erzeugt, die ausgewiesenen Zahlen spiegeln möglicherweise nicht wider, ob tatsächlich Endkunden für die entwickelten Produkte zahlen würden.
Dieses Phänomen erinnert an das sogenannte “Vendor Financing”, bei dem Verkäufer die Käufe ihrer eigenen Produkte finanzieren, um Umsätze zu generieren. Eine Praxis, die in der Dotcom-Ära der späten 1990er-Jahre bereits zu spektakulären Zusammenbrüchen führte. Damals wie heute gilt: Wenn Geld nur verschoben wird, ohne dass echte Wertschöpfung stattfindet, kann daraus eine Spekulationsblase entstehen. Der entscheidende Unterschied zur Jahrtausendwende: Die heutigen Summen sind um ein Vielfaches grösser, die Vernetzung ist global, und die systemische Bedeutung der beteiligten Unternehmen ist enorm gewachsen.
Für Aussenstehende wird es zunehmend schwierig, die wahre finanzielle Gesundheit eines Unternehmens zu bewerten. Die ausgewiesenen Umsätze suggerieren Marktstärke, die tatsächliche Kundenakzeptanz bleibt jedoch unklar. Investoren treffen Entscheidungen auf Basis von Zahlen, die primär aus internen Kapitalflüssen resultieren.
Diese Intransparenz ist nicht nur ein Problem für professionelle Anleger - sie betrifft auch private Sparer, deren Pensionsfonds massiv in diese Unternehmen investiert sind. Die Frage ist nicht, ob diese Struktur problematisch ist, sondern wann sie zu einem Problem wird.
-WERBUNG-
Mehr KI Kompetenz? Inkl. Kompetenznachweis? Dazu haben wir das KI-Update entwickelt, immer jeden Montag Abend für Members und völlig kostenlos jeden 2ten Montagabend zum reinschnuppern. Mehr Infos gibts auf:
Europa im Kreislauf: Souveränität mit Risiken
Zirkuläre Deals sind aber kein rein amerikanisches Phänomen. Das französische KI-Startup Mistral hat über zwei Milliarden Dollar eingesammelt, teilweise von Konzernen, bei denen es anschliessend Hardware und Dienstleistungen bezieht. Die Europäische Union finanziert mit Milliardenbeträgen den Aufbau von KI-Gigafabriken, in denen zahlreiche Startups Entwicklungskapazitäten mieten - finanziert durch Investitionsrunden, die wiederum an Infrastruktur- und Technologiepartner zurückfliessen.
Ein Unterschied zu den USA liegt aber in der stärkeren Rolle öffentlicher Akteure. Viele europäische Deals werden als öffentlich-private Partnerschaften strukturiert, mit dem erklärten Ziel, digitale Souveränität gegenüber amerikanischen und chinesischen Technologiekonzernen zu sichern. Die Kreislauf-Logik bleibt jedoch dieselbe. Die Risiken von künstlichem Wachstum und Intransparenz existieren auch hier, werden aber oft von politischen Zielsetzungen überlagert. Europa mag einen anderen Weg gehen wollen – doch die grundlegenden Mechanismen ähneln sich verblüffend.
Platzt die Blase wirklich?
Die Geschichte der Finanzmärkte zeigt: Blasen platzen nicht, weil fundamentale Daten sich verschlechtern, sondern weil das Vertrauen schwindet. Mehrere Szenarien sind denkbar. Ein KI-Labor könnte seine Finanzierung nicht verlängern können, weil Zweifel an der Profitabilität aufkommen. Dies würde bedeuten, dass geplante Chip- und Cloud-Käufe ausbleiben, was die Umsatzerwartungen der Lieferanten enttäuscht. Deren Aktienkurse würden fallen, was ihre Finanzierungsfähigkeit beeinträchtigt und weitere Investitionen gefährdet.
Das gefährlichste Szenario wäre ein Vertrauensverlust, der sich selbst verstärkt. Sobald Investoren erkennen, dass ein erheblicher Teil des KI-Booms auf zirkulären Finanzierungen basiert, könnten sie beginnen, ihre Positionen zu reduzieren. Fallende Kurse würden weitere Verkäufe auslösen, die Liquidität würde sich verschlechtern, und was als kontrollierte Korrektur beginnt, könnte in eine Panik münden. Die globale Vernetzung der Finanzmärkte würde dafür sorgen, dass sich die Krise nicht auf einzelne Sektoren beschränkt.
Im Vergleich zur Dotcom-Blase unterscheidet sich die heutige Situation in wesentlichen Punkten. Die beteiligten Unternehmen sind heute deutlich grösser, profitabler und systemrelevanter als die Internet-Startups von damals. Cloud-Dienste sind zur Infrastruktur geworden, auf die Unternehmen aller Branchen angewiesen sind. KI-Technologien durchdringen zunehmend Produktionsprozesse, Logistik und Dienstleistungen. Ein Kollaps dieser Unternehmen würde nicht nur Aktienkurse betreffen, sondern könnte die Funktionsfähigkeit ganzer Wirtschaftszweige beeinträchtigen.
Millionen von Menschen haben ihre Altersvorsorge in Pensionsfonds angelegt, die massiv in die betroffenen Technologiekonzerne investiert sind. Indexfonds, die den S&P 500 oder den Nasdaq abbilden, enthalten diese Unternehmen in erheblichem Umfang. Was wie eine sichere, diversifizierte Anlage erscheint, birgt durch die Konzentration und Verflechtung erhebliche Klumpenrisiken.
Die potentiellen Auswirkungen eines Zusammenbruchs wären nicht auf die Finanzmärkte beschränkt. Sinkende Pensionsfondsrenditen würden die Altersvorsorge beeinträchtigen, fallende Immobilienwerte könnten folgen, die Kreditvergabe könnte sich verschärfen. Die globale Vernetzung der Finanzmärkte würde dafür sorgen, dass sich eine Krise rasch ausbreitet. Hinzu kommt die psychologische Dimension: Das Vertrauen in Finanzmärkte und Institutionen hat seit der Finanzkrise 2008 gelitten. Ein erneuter grosser Zusammenbruch könnte dieses Vertrauen nachhaltig beschädigen.
Zwischen Innovation und Illusion?
Die Entwicklung künstlicher Intelligenz ist zweifellos eine der bedeutendsten technologischen Revolutionen unserer Zeit. Doch die Art der Finanzierung wirft fundamentale Fragen auf. Die zentrale Herausforderung besteht darin, zwischen legitimer Innovation und spekulativer Übertreibung zu unterscheiden. Wenn Umsätze primär aus gegenseitigen Finanzierungen statt aus echter Kundennachfrage entstehen, wenn Bewertungen auf Hoffnungen statt auf Fundamentaldaten basieren - dann sollten Alarmglocken läuten.
Darum werden immer mehr und mehr Firmen auch ihre LLM Dienste lokal oder in Private Clouds laufen lassen - dazu nächste Woche mehr im Newsletter von mir.
Regulierungsbehörden stehen vor einem Dilemma. Zu strenge Vorgaben könnten Innovation hemmen. Zu laxe Aufsicht könnte jedoch eine Blase ermöglichen, deren Platzen weitreichende wirtschaftliche Schäden verursacht. Der richtige Weg liegt in erhöhter Transparenz, strengeren Offenlegungspflichten und kritischer Bewertung von Verflechtungen. Investoren, Analysten und die Öffentlichkeit brauchen die Möglichkeit zu verstehen, welcher Teil des berichteten Wachstums auf echter Nachfrage basiert und welcher auf internen Kapitalflüssen. Erst dann können informierte Entscheidungen getroffen werden.
Und genau deshalb bin ich überzeugt: Die Zukunft entsteht dort, wo wir aufhören, Kapital nur im Kreis zu drehen, und anfangen, Wissen, Kreativität und Technologie wirklich zu verbinden. Wir stehen am Anfang einer neuen Ära, in der Mensch und Maschine nicht mehr gegeneinander, sondern gemAInsam denken und handeln.
Eine Zeit, in der Sprache zur Brücke wird - nicht nur zwischen Menschen, sondern auch zwischen Mensch und System. Wenn Du diese Zukunft mitgestalten willst: melde Dich auf www.rogerbasler.ch.
Disclaimer: Dieser Artikel wurde nach meinem eigenen Wissen und dann mit Recherchen mit KI (Perplexity.Ai und Grok.com sowie Gemini.Google.com) manuell zusammengestellt und mit Deepl.com/write vereinfacht. Der Text wird dann nochmals von zwei Personen meiner Wahl gelesen und kritisch hinterfragt. Das Bild stammt von Ideogram.Ai und ist selbst erstellt. Dieser Artikel ist rein edukativ und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Bitte melde dich, wenn Du Ungenauigkeiten feststellst, danke.
Quellen und weitere Informationen:
Acadian Asset Management. (2024). Straight talk about circular deals in AI. https://www.acadian-asset.com/investment-insights/owenomics/straight-talk-about-circular-deals-in-ai
Beam AI. (2024). The $1 trillion question: Is the AI boom built on circular deals or real demand? https://beam.ai/agentic-insights/the-1-trillion-question-is-the-ai-boom-built-on-circular-deals-or-real-demand
CNBC. (2025, Oktober 15). A guide to $1 trillion worth of AI deals between OpenAI, Nvidia. https://www.cnbc.com/2025/10/15/a-guide-to-1-trillion-worth-of-ai-deals-between-openai-nvidia.html
Europäische Kommission. (2025a, Februar 11). Milliarden-Initiative soll Europa zu einem KI-Kontinent machen. https://germany.representation.ec.europa.eu/news/milliarden-initiative-soll-europa-zu-einem-ki-kontinent-machen-2025-02-11_de
Finanzen.net. (2024). KI-Boom à la Dotcom: Fondsmanager warnen vor Blase bei Tech-Aktien um Nvidia, AMD und Co. https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/ueberbewertet-ki-boom-la-dotcom-fondsmanager-warnen-vor-blase-bei-tech-aktien-um-nvidia-amd-und-co-15097314
Harvard Business Review. (2025, Oktober). Is AI a boom or a bubble? https://hbr.org/2025/10/is-ai-a-boom-or-a-bubble