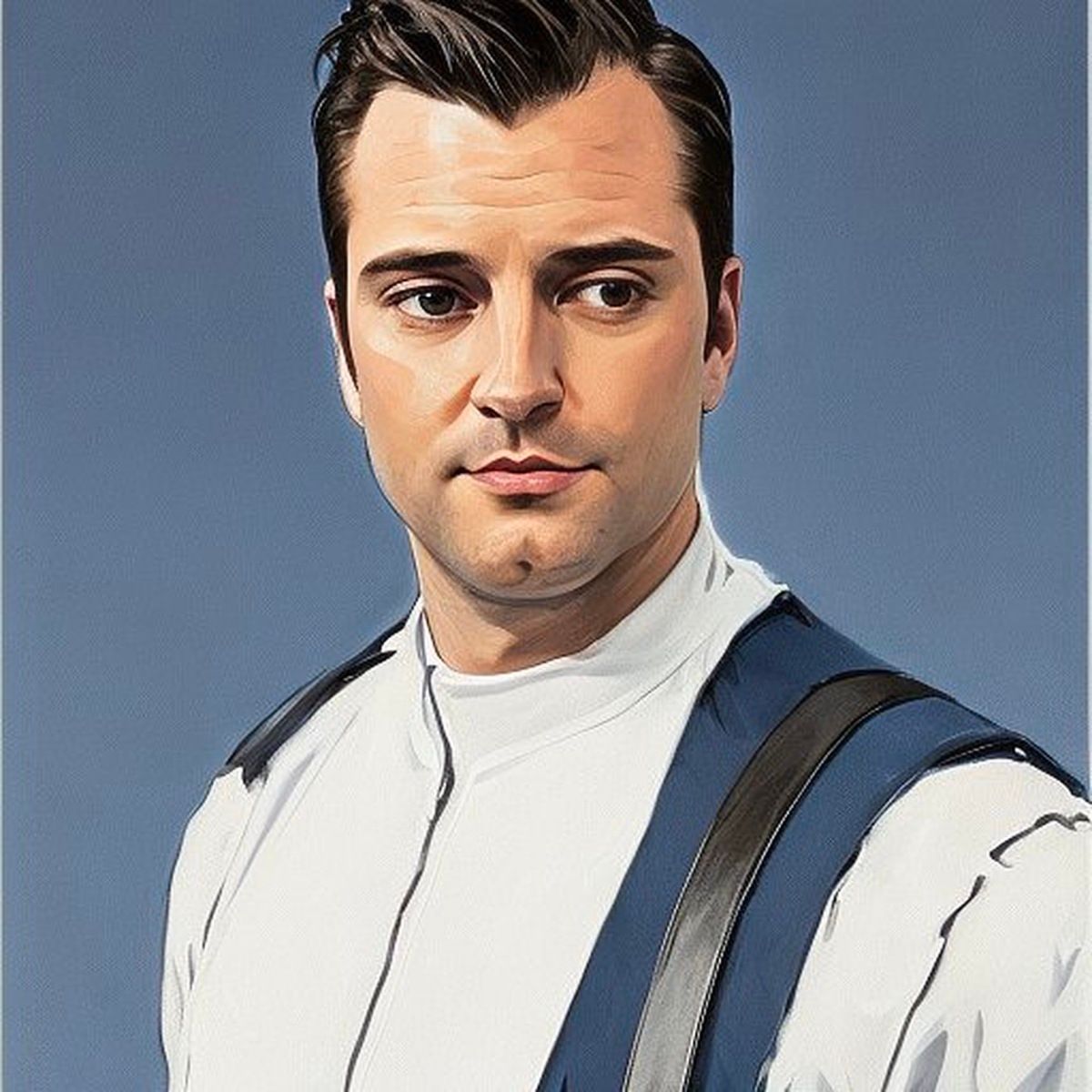TLDR: Die rasante Verbreitung von KI-Assistenten wie ChatGPT hat eine kontroverse Debatte ausgelöst: Werden wir durch diese Technologie dümmer oder bloss fauler? Eine neue Studie von OpenAI zeigt, wie Menschen ChatGPT tatsächlich nutzen, während gleichzeitig Schweden eine bemerkenswerte Kehrtwende vollzieht und wieder verstärkt auf gedruckte Schulbücher setzt. Diese scheinbar widersprüchlichen Entwicklungen werfen wichtige Fragen über die Zukunft des Lernens und Denkens auf. Denn die Antwort ist komplexer als ein einfaches «ja» oder «nein» - sie hängt davon ab, wie wir diese Werkzeuge einsetzen und welche kognitiven Prozesse wir dabei auslagern.
Die schwedische Kehrtwende: Ein Realitätscheck für die Digitalisierung
Schweden vollzieht derzeit eine der bemerkenswertesten bildungspolitischen Wenden der letzten Jahrzehnte. Das Land, das einst als Vorbild für die Digitalisierung des Bildungswesens galt, investiert nun hunderte Millionen Kronen in die Rückkehr zu gedruckten Schulbüchern. Diese Entscheidung ist keine technologiefeindliche Reaktion, sondern basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen über die Auswirkungen früher und intensiver Bildschirmnutzung auf die kognitive Entwicklung.
Bildungsministerin Lotta Edholm begründet die Massnahme mit dem Prinzip «mehr Lesezeit, weniger Bildschirmzeit». Die Regierung verweist auf Studien, die zeigen, dass bildschirmfreie Umgebungen den Erwerb von Grundkompetenzen wie Lesen, Schreiben und Konzentration fördern. Besonders in den ersten Schuljahren scheint übermässige Digitalisierung kontraproduktiv zu sein - eine Erkenntnis, die auch internationale Organisationen wie die UNESCO unterstützen.
Diese Entwicklung steht in direktem Zusammenhang mit nachlassenden Leistungen in standardisierten Tests und wachsenden Sorgen um die Grundkompetenzen schwedischer Schüler. Die schwedische Erfahrung illustriert ein zentrales Problem: Die unreflektierte Einführung digitaler Werkzeuge kann unbeabsichtigte Konsequenzen haben, wenn sie fundamentale kognitive Prozesse untergräbt.
Das Phänomen des kognitiven Offloadings verstehen
Um die Auswirkungen von KI auf unser Denken zu verstehen, müssen wir das Konzept des kognitiven Offloadings genauer betrachten. Dieser Begriff beschreibt die Nutzung externer Hilfsmittel zur Reduzierung der mentalen Belastung. Historisch war dies ein gradueller Prozess: Die Erfindung der Schrift entlastete das Gedächtnis, der Abakus und später der Taschenrechner übernahmen arithmetische Berechnungen, und das Internet wurde zu unserem externen Informationsspeicher.
KI-Systeme wie ChatGPT repräsentieren jedoch einen qualitativen Sprung. Sie übernehmen nicht nur einzelne kognitive Teilfunktionen, sondern können komplexe Themen durch Analyse, Synthese, Argumentation und Schreibprozesse die wichtig sind fürs lernen, ausführen (dazu später unten in den Studienergebnissen). Wenn ein:e Nutzer:In ChatGPT bittet, einen Geschäftsplan zu erstellen, eine wissenschaftliche Frage zu beantworten oder ein Problem zu lösen, wird der gesamte kognitive Arbeitsprozess externalisiert.
Die Entscheidung für kognitives Offloading basiert auf einer meist unbewussten Kosten-Nutzen-Rechnung. KI-Systeme senken die Kosten der Externalisierung dramatisch: Was früher Stunden intensiver geistiger Arbeit erforderte, kann nun in Sekunden erledigt werden. Diese beispiellose Effizienz macht das Offloading zur Standardoption und fördert eine Gewohnheit, bei der die Auslagerung von Denkprozessen nicht mehr die Ausnahme, sondern die Regel wird. Und wir Menschen sind nun mal sehr gut darin, Energie zu sparen. Also wenn wir es können, tun wir es auch.
Die theoretischen Grundlagen: Wie unser Gehirn lernt
Die Cognitive Load Theory (CLT) liefert das wissenschaftliche Fundament für das Verständnis dieser Prozesse. Entwickelt von John Sweller, basiert sie auf zwei fundamentalen Erkenntnissen über die menschliche Kognition: Erstens ist die Kapazität unseres Arbeitsgedächtnisses - der Teil des Gedächtnisses, der neue Informationen aktiv verarbeitet - stark begrenzt. Es kann typischerweise nur drei bis sieben Informationseinheiten gleichzeitig handhaben. Zweitens ist die Kapazität unseres Langzeitgedächtnisses praktisch unbegrenzt.
Im Langzeitgedächtnis wird Wissen in Form von Schemata organisiert - kognitiven Strukturen, die multiple Informationselemente zu sinnvollen Einheiten verbinden. Das Schema für «Autofahren» beispielsweise integriert unzählige Einzelfertigkeiten wie Lenken, Bremsen, Schalten und Verkehrsregeln zu einer fliessenden Handlung. Der Lernprozess ist im Wesentlichen der Aufbau und die Automatisierung solcher Schemata.
Die CLT unterscheidet drei Arten kognitiver Belastung:
Intrinsische Belastung ergibt sich aus der natürlichen Komplexität des Lernmaterials. Diese ist für ein gegebenes Thema und einen bestimmten Lernenden unvermeidbar, kann aber durch geschickte Strukturierung gesteuert werden.
Extrinsische Belastung entsteht durch schlechte Gestaltung von Lernmaterialien oder unnötige Ablenkungen. Diese Art der Belastung ist kontraproduktiv und sollte minimiert werden.
Lernbezogene Belastung ist die produktive, wünschenswerte Anstrengung, die direkt dem Verstehen und dem Aufbau von Schemata dient. Sie ist der eigentliche Motor des Lernens.
Hier offenbart sich das zentrale Paradox der KI: Während sie exzellent darin ist, extrinsische Belastung zu reduzieren, besteht die Gefahr, dass sie auch die für das Lernen essenzielle lernbezogene Belastung eliminiert. Wenn ChatGPT die Analyse durchführt, die Gliederung erstellt oder die Schlussfolgerungen zieht, nimmt es dem Lernenden genau jene anspruchsvolle kognitive Arbeit ab, die für den Aufbau robuster Wissensschemata notwendig ist.
-WERBUNG-
Lernen geht auch anders - in der Anwendung, nicht zu hören, mitmachen! Dazu haben wir das KI-Update entwickelt, immer jeden Montag Abend für Members und völlig kostenlos jeden 2ten Montagabend zum reinschnuppern. Mehr Infos gibts auf:
Neurowissenschaftliche Evidenz: Das Gehirn unter KI-Einfluss
Die bisher überzeugendste Evidenz für die Auswirkungen von KI auf die menschliche Kognition liefert eine bahnbrechende Studie des MIT Media Lab. Nathalie Kosmyna und ihr Team untersuchten mittels Elektroenzephalographie (EEG) die Gehirnaktivität von 54 Probanden beim Verfassen von Aufsätzen. Das rigorose experimentelle Design umfasste drei Gruppen: eine ohne Hilfsmittel («Brain-only»), eine mit Internetzugang («Search»), und eine mit ChatGPT-4o-Unterstützung («LLM»).
Die Ergebnisse waren eindeutig und alarmierend: Die Gehirnkonnektivität - ein Mass für die Kommunikation zwischen verschiedenen Hirnregionen - nahm systematisch mit dem Grad der externen Unterstützung ab. Die LLM-Gruppe zeigte eine um bis zu 55 Prozent geringere neuronale Kopplung verglichen mit der Brain-only-Gruppe. Besonders betroffen waren zwei kritische Frequenzbänder:
Alpha-Wellen, die mit kreativem Denken und interner Ideengenerierung assoziiert sind, waren bei ChatGPT-Nutzern deutlich schwächer ausgeprägt. Dies deutet darauf hin, dass das Gehirn weniger in jene Prozesse involviert war, die für die Entwicklung origineller Gedanken erforderlich sind.
Beta-Wellen, die mit anhaltender Konzentration und aktivem Denken verbunden sind, zeigten ebenfalls reduzierte Konnektivität. Dies legt nahe, dass KI-Nutzung zu einem Zustand geringerer geistiger Anstrengung und Wachheit führt.
Das vielleicht beunruhigendste Ergebnis trat in der vierten Sitzung zutage. Teilnehmer:Innen, die zuvor ChatGPT genutzt hatten, mussten nun ohne KI-Unterstützung schreiben. Ihre Gehirnaktivität blieb auch ohne KI signifikant reduziert - ein Phänomen, das die Forscher:Innen als «kognitive Schuld» bezeichnen. Dies ist der direkte neurophysiologische Beweis dafür, dass intensive KI-Nutzung zu erlernten Mustern neuronaler Unteraktivierung führt, die auch dann bestehen bleiben, wenn die technologische Unterstützung wegfällt.
Diese Befunde wurden durch Verhaltensdaten untermauert: LLM-Nutzer:Innen berichteten über das geringste Gefühl der Urheberschaft für ihre Texte und hatten signifikante Schwierigkeiten, aus ihren eigenen Aufsätzen zu zitieren - ein Hinweis auf oberflächliche Verarbeitung und schlechte Gedächtnisverankerung.
Weitere empirische Belege für kognitives Offloading
Die MIT-Studie steht nicht allein. Eine wachsende Zahl von Untersuchungen dokumentiert spezifische kognitive Beeinträchtigungen durch übermässige Technologienutzung:
Gedächtnisverschlechterung: Der «Google-Effekt», erstmals von Betsy Sparrow und Kollegen beschrieben, zeigt, dass Menschen Informationen signifikant schlechter behalten, wenn sie wissen, dass diese digital verfügbar sind. Das Gehirn scheint strategisch zu entscheiden, sich nicht die Information selbst zu merken, sondern nur den Pfad zu ihrer Wiederbeschaffung. Eine Folgestudie von Akgun und Toker (2024) fand, dass längere KI-Exposition bei Studierenden zu messbaren Rückgängen der Gedächtnisleistung führte.
Erosion des kritischen Denkens: Michael Gerlich von der Swiss Business School führte eine umfassende Studie mit 666 Teilnehmern durch, die eine signifikante negative Korrelation zwischen KI-Nutzungshäufigkeit und Leistungen im Halpern Critical Thinking Assessment fand. Besonders alarmierend: Jüngere Nutzer im Alter von 17-25 Jahren, die KI-Tools am häufigsten verwendeten, zeigten die schlechtesten Werte beim kritischen Denken. Als Mechanismus identifizierte die Studie die «Delegation von Denkaufgaben» an die KI.
Beeinträchtigung der Problemlösungsfähigkeit: Studien zeigen, dass ständiges Zurückgreifen auf KI zur Problemlösung die eigenständigen analytischen Fähigkeiten und die kognitive Flexibilität untergraben kann. Eine besonders aufschlussreiche Untersuchung zur Kreativität ergab ein paradoxes Ergebnis: KI-unterstützte Gruppen erzielten zwar bessere quantitative Kreativitätsmetriken, litten aber unter «kognitiver Fixierung» und zeigten geringeres kreatives Selbstvertrauen.
Räumliche Orientierung: GPS-Navigationsstudien liefern ein anschauliches Beispiel für aktivitätsspezifische Atrophie. Personen, die häufig GPS-Systeme nutzen, zeigen messbare Verschlechterungen des räumlichen Gedächtnisses und der natürlichen Orientierungsfähigkeit - ein klarer Fall von «use it or lose it».
Der ChatGPT-Effekt: Erkenntnisse aus der OpenAI-Studie
Und passen dazu kam diese Woche ja noch eine Studie heraus: Eine aktuelle Analyse von OpenAI mit 1,5 Millionen ChatGPT-Gesprächen aus dem Zeitraum Mai 2024 bis Juni 2025 liefert aufschlussreiche Einblicke in die realen Nutzungsmuster. Die Ergebnisse relativieren einige Annahmen über KI-Nutzung und verstärken andere Bedenken.
Alltagsdominanz: Die grösste Kategorie ist «praktische Anleitung» mit 28 Prozent aller Interaktionen. Dies umfasst How-to-Fragen, Lernhilfe, Fitness- und Gesundheitsberatung sowie Alltagsorganisation. Schreiben rangiert als zweitgrösste Kategorie, wobei das Redigieren und Korrigieren vorhandener Texte dominiert.
Der Shift zur Privatnutzung: Besonders bemerkenswert ist die Verschiebung von beruflicher zu privater Nutzung. Während 2024 etwa die Hälfte aller Nachrichten berufsbezogen war, sind es 2025 nur noch 27 Prozent. Dies deutet darauf hin, dass ChatGPT zunehmend als persönlicher Assistent für Alltagsfragen fungiert.
Programmierung überraschend gering: Entgegen der populären Wahrnehmung machen programmierbezogene Anfragen nur 4,2 Prozent aller Gespräche aus. Dies zeigt, dass die öffentliche Debatte oft von technischen Anwendungsfällen dominiert wird, während die Masse der Nutzer ChatGPT für grundlegendere kognitive Aufgaben verwendet.
Asking versus Doing: Etwa die Hälfte aller Nachrichten fällt in die Kategorie «Asking» (Rat und Erklärungen suchen), während die andere Hälfte «Doing» (konkrete Aufgaben erledigen lassen) umfasst. Im beruflichen Kontext dominiert jedoch das «Doing», besonders bei Schreibaufgaben.
Diese Nutzungsmuster sind aus kognitiver Sicht besonders problematisch, weil sie zeigen, dass ChatGPT häufig für fundamentale geistige Tätigkeiten eingesetzt wird - das Verstehen von Konzepten, das Formulieren von Texten und das Lösen alltäglicher Probleme. Gerade diese Bereiche sind jedoch essentiell für die Entwicklung und Aufrechterhaltung kognitiver Grundfähigkeiten.
Die Verbindung zwischen schwedischer Bildungspolitik und KI-Forschung
Schwedens Rückkehr zu gedruckten Schulbüchern und die Befunde zur KI-induzierten kognitiven Erosion und die aktuelle ChatGPT Studie sind keine unabhängigen Phänomene. Sie reflektieren ein gemeinsames Verständnis darüber, wie fundamentale kognitive Fähigkeiten entwickelt werden.
Die schwedische Entscheidung basiert auf der Erkenntnis, dass bildschirmbasierte Medien in frühen Lernphasen kontraproduktiv sein können. Gedruckte Texte fördern tieferes Lesen, längere Aufmerksamkeitsspannen und bessere Gedächtniskonsolidierung. Diese Befunde decken sich mit den neurowissenschaftlichen Erkenntnissen über KI-Nutzung: Wenn externe Systeme zu früh oder zu umfassend eingesetzt werden, können sie die Entwicklung interner kognitiver Strukturen behindern.
Die Parallele wird besonders deutlich, wenn man die Cognitive Load Theory auf beide Kontexte anwendet. Sowohl übermässige Bildschirmnutzung in Schulen als auch unreflektierte KI-Nutzung können die lernbezogene Belastung eliminieren, die für den Aufbau robuster Wissensschemata erforderlich ist. In beiden Fällen führt die scheinbare Effizienzsteigerung zu langfristigen kognitiven Kosten.
Besonders kritisch ist die potenzielle Entstehung einer «kognitiven Kluft» zwischen jenen, die KI-Tools strategisch und bewusst nutzen, und jenen, die von ihnen abhängig werden. Erstere könnten ihre kognitiven Fähigkeiten durch intelligente Nutzung sogar erweitern, während letztere messbare Einbussen erleiden.
Abhängigkeit versus strategisches Offloading
Und dass Du mich richtig verstehst: Nicht jede Form des kognitiven Offloadings ist problematisch. Die Forschung unterscheidet zwischen strategischem Offloading - der bewussten Entscheidung, bestimmte Aufgaben zu delegieren, um Ressourcen für wichtigere Tätigkeiten freizusetzen - und kognitiver Abhängigkeit.
Strategisches Offloading kann durchaus vorteilhaft sein. Eine Anwältin kann KI für die Erstanalyse von Rechtsdokumenten nutzen und sich auf die strategische Beratung konzentrieren. Ein Forscher kann Literaturzusammenfassungen automatisieren und mehr Zeit für die Entwicklung neuer Hypothesen aufwenden.
Die Erkenntnisse über kognitives Offloading und dessen Auswirkungen haben weitreichende Konsequenzen für den Berufsalltag und Bildung. Ein pauschales Verbot von KI-Tools ist weder praktikabel noch wünschenswert, da diese bereits tief in der Arbeits- und Lebenswelt verankert sind. Stattdessen ist eine neue Pädagogik erforderlich, die die Chancen der Technologie nutzt und gleichzeitig ihre Risiken aktiv mitigiert.
Die Diskussion über KI und Kognition hat Auswirkungen, die weit über individuelle Lernprozesse hinausgehen. Wenn ganze Generationen in einer Umgebung aufwachsen, in der komplexe kognitive Aufgaben routinemässig an Maschinen delegiert werden, könnte dies fundamentale Veränderungen in der kognitiven Kultur der Gesellschaft bewirken.
Schwedens Vorgehen ist Teil einer breiteren internationalen Diskussion über die angemessene Integration digitaler Technologien in die Bildung. Die UNESCO mahnt einen «angemessenen» Technikeinsatz an, der lehrergeleiteten Unterricht ergänzt, aber nicht ersetzt. Frankreich diskutiert ähnliche Massnahmen, und auch in Deutschland mehren sich kritische Stimmen zur unreflektierten Digitalisierung des Bildungswesens.
Diese Entwicklungen spiegeln ein wachsendes Bewusstsein dafür wider, dass Technologie kein Selbstzweck ist, sondern pädagogisch begründet und dosiert eingesetzt werden muss. Die anfängliche Euphorie über die Möglichkeiten digitaler Bildung weicht einer evidenzbasierten Diskussion über Nutzen und Risiken.
Gestaltung einer kognitiv nachhaltigen Zukunft
Die Zukunft der menschlichen Kognition im Zeitalter der KI ist nicht vorherbestimmt. Sie hängt von den Entscheidungen ab, die wir heute treffen - als Individuen, Pädagogen, Technologen und Gesellschaft.
Die schwedische Rückkehr zu gedruckten Schulbüchern und die neurowissenschaftlichen Befunde zur KI-Nutzung liefern wichtige Orientierungspunkte: Fundamentale kognitive Fähigkeiten müssen geschützt und aktiv gepflegt werden. Dies erfordert bewusste Entscheidungen zur Begrenzung und strukturierten Nutzung von KI-Tools, insbesondere in formativen Lernphasen.
Gleichzeitig müssen wir das transformative Potenzial der KI anerkennen. Richtig eingesetzt, kann sie als kognitiver Verstärker fungieren, der menschliche Intelligenz erweitert, anstatt sie zu ersetzen. Der Schlüssel liegt in der Entwicklung von neuen KI Kompetenzen und wann und wie Technologie einzusetzen ist, um menschliche Potenziale zu maximieren, ohne sie zu untergraben.
siehe auch hier:
Die Evidenz ist klar: Unkritische KI-Nutzung macht uns messbar «fauler». Aber bewusste, strategische Nutzung könnte uns klüger machen, als wir jemals waren. Die Wahl liegt bei uns.
Und darum bin ich nach wie vor überzeugt: Wir müssen mehr lernen zu lernen. Also wenn Du reden willst, und wenn Du mit mir zusammenarbeiten willst: melde Dich gerne www.rogerbasler.ch
Disclaimer: Dieser Artikel wurde nach meinem eigenen Wissen und dann mit Recherchen mit KI (Perplexity.Ai und Grok.com sowie Gemini.Google.com) manuell zusammengestellt und mit Deepl.com/write vereinfacht. Der Text wird dann nochmals von zwei Personen meiner Wahl gelesen und kritisch hinterfragt. Das Bild stammt von Ideogram.Ai und ist selbst erstellt. Dieser Artikel ist rein edukativ und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Bitte melde dich, wenn Du Ungenauigkeiten feststellst, danke.
Quellen und weitere Informationen:
Edholm, L. (2024, Februar). Government investing in more reading time and less screen time. Schwedische Regierung. https://www.government.se/articles/2024/02/government-investing-in-more-reading-time-and-less-screen-time/
Gerlich, M. (2025). Critical thinking in the age of AI: A correlation study. Swiss Business School Research Journal, 8(2), 45-62. https://www.researchgate.net/publication/387701784_AI_Tools_in_Society_Impacts_on_Cognitive_Offloading_and_the_Future_of_Critical_Thinking
Ishizaka, K., Marshall, S. P., & Conte, J. M. (2001). Individual differences in attentional strategies in multitasking situations. Human Performance, 14(4), 339-358. https://psycnet.apa.org/record/2001-11710-004
Kosmyna, N., Tarpin-Bernard, F., & Rieger, B. (2025). Your brain on ChatGPT: Accumulation of cognitive debt when using an AI assistant for essay writing task. MIT Media Lab Working Paper, arXiv:2506.08872. https://arxiv.org/abs/2506.08872
OpenAI. (2025). How people use ChatGPT: A comprehensive analysis of usage patterns. Economic Research Paper. https://cdn.openai.com/pdf/a253471f-8260-40c6-a2cc-aa93fe9f142e/economic-research-chatgpt-usage-paper.pdf
Risko, E. F., & Gilbert, S. J. (2016). Cognitive offloading. Trends in Cognitive Sciences, 20(9), 676-688. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27542527/
Spannagel, C. (2025). ChatGPT und die Zukunft des Lernens: Evolution statt Revolution. Hochschulforum Digitalisierung. https://hochschulforumdigitalisierung.de/chatgpt-und-die-zukunft-des-lernens-evolution-statt-revolution/